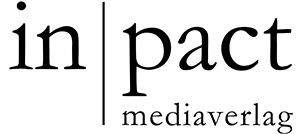Zugleich wächst die Verunsicherung angesichts von Manipulationen und Betrug in der digitalen Finanzwelt. Über die Digitalisierung der Banken, der Geldanlageprodukte und des Geldes sprachen wir mit Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim. Und über die wohl härteste Währung in der Finanzbranche: Vertrauen.
Herr Professor Burghof, die Corona-Krise hat in vielen Wirtschaftsbereichen die Geschwindigkeit der Digitalisierung erhöht. Auch bei den Banken?
Ja, zumindest in dieser Beziehung hatte die Corona-Krise positive Effekte. Allerdings agieren Banken hier mit deutlicher Verzögerung, aus gutem Grund: Banken sollten konservative Institutionen sein, weil sie Vertrauen erwecken wollen. Sie müssen Reputation aufbauen und an Traditionen anschließen können. Dies spricht dagegen, dass sie sich zu rasch wandeln. Deshalb geht hier die Einführung neuer Errungenschaften immer ein wenig behäbiger vonstatten als woanders.
Ist das angesichts des disruptiven Wandels in der globalen Finanzwelt nicht von Nachteil?
Nicht unbedingt. Kundenbeziehungen zu Banken sind in der Regel langfristig, und daran geknüpft sind langfristige Verhaltenserwartungsmuster an das Gegenüber. Ein weiterer Grund: Banken haben tendenziell mit älterer Kundschaft zu tun – zwar nicht in der Zahl der Kontakte, aber in der Intensität und in der Höhe der bewegten Geldsummen. Ältere verfügen im Durchschnitt über ein höheres Vermögen. Auch dies kann dazu führen, dass Banken sich ein wenig langsamer digitalisieren als andere Unternehmen.
Wirken deshalb mitunter Banken in ihrer Kundenansprache so altbacken?
Die Kommunikation ist sicher ein wichtiger Aspekt. Viele Traditionsbanken mussten erst lernen, wie man junge Menschen anspricht, wie man eine attraktive App aufbaut. Lange haben sie am Zweigstellensystem festgehalten. Das ist auch verständlich, weil regionale Nähe auch Vertrauen schafft. Viele Deutsche verstehen sich als Weltbürger und Europäer, finden es aber zugleich wichtig, dass Menschen mit regionaler Bindung und entsprechenden Werten sich um ihr Geldvermögen kümmern. Das unterscheidet uns zum Beispiel von den USA. Eine US-amerikanische Studie hat untersucht, welche moralischen Werte US-Banker vertreten und sie mit ihrem Umfeld verglichen. Heraus kam, dass sie andere Werte vertreten als ihre Umgebung. Wir haben in unserer Zeitschrift Credit and Capital Markets eine ähnliche Studie zu deutschen Genossenschaftsbanken von Kai-Oliver Mauerer veröffentlicht. Der kommt zu dem Ergebnis, dass hiesige Banker mit ihrem Wertesystem recht nahe bei ihren Kunden sind.
Sind Vertrauen und Digitalisierung Gegensätze?
Das kommt auf den Bereich an. Funktionen wie Überweisungen und Transaktionen haben im nicht-digitalen Bereich nichts mehr zu suchen. Aber bei der Beratung ist das anders. Am Ende muss ein menschliches Gesicht dahinterstehen. Die Banken müssen den Spagat bewältigen, die Digitalisierung einzuführen und zugleich das mühsam aufgebaute Vertrauen nicht zu verspielen. Auf der anderen Seite tauchen Direktbanken auf dem Markt auf, die ihre Prozesse mit Hilfe der Digitalisierung extrem effizient getrimmt haben. Aber: Genießen sie wirklich Vertrauen?
Die Direktbanken sind recht erfolgreich...
...dort, wo es um reine Transaktionen geht. Aber Sie haben recht, ich bin teilweise erstaunt, wie viel Vertrauensvorschuss die Kunden ihnen einräumen. Wenn ich mir anschaue, wie sie teilweise mit ihren Kunden umgehen und ich mir dann vorstelle, so etwas würde bei der Commerzbank oder der Deutschen Bank passieren – es gäbe einen riesigen Aufschrei in den Medien und sozialen Netzwerken.
Einen Aufschrei hat es gegeben, als Bilanzfälschungen beim Fintech- und ehemaligen Dax-Unternehmen Wirecard aufflogen. Das traf nicht nur Anleger heftig, weil der Aktienkurs einbrach, auch digitale Technologien wie Blockchain, Kryptowährungen, Token stehen plötzlich unter Generalverdacht. Zu Recht?
Man darf das nicht zusammenmischen: Block-chain, Krypto, Tokens – ich bin überzeugt, dass gewaltige Möglichkeiten in diesen Technologien stecken. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Bankenaufsicht auf dem Fintech-Auge blind ist. Sie will Innovation nicht verhindern, das ist der positive Aspekt. Auf der anderen Seite sieht sie offenbar die neuen Risiken nicht, die daraus erwachsen. Auch das digitale Bankgeschäft unterliegt den Gesetzen der Ökonomie.
Deutsche Beamte genießen nicht gerade den Ruf, so technologieaffin zu sein, dass sie über Gesetze hinwegsehen. Haben wir zu wenig Regulierung?
Nein, im Gegenteil: Wir haben eine Überregulierung, die nicht ökonomische, sondern juristische Perfektion anstrebt. Nehmen Sie als Beispiel ein Fintech-Unternehmen, welches Einlagen deutscher Kunden an Banken in Europa vermittelt, die deutlich höhere Zinsen bieten als am deutschen Markt üblich. Den Kunden wird der Eindruck vermittelt: Mein Vermögen ist sicher, egal ob es in Portugal, Griechenland oder in Deutschland angelegt wird. Was verschwiegen wird ist, dass die unterschiedliche Zinshöhe auch unterschiedliche Risiken abbildet. Aus politischer Sicht ist es gewünscht, dass Kunden den gemeinsamen Kapitalmarkt nutzen und ihr Geld auch in anderen europäischen Ländern anlegen. Aber es spiegelt ein vollkommen falsches Verständnis der Bankenmärkte wider. Juristisch mag das einwandfrei sein, ökonomisch ist es eine Katastrophe.
Ist die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, mit der Überwachung von digitalen Finanzdienstleistern überfordert?
Ganz offensichtlich, ja. Auch Wirecard ist lückenlos reguliert worden – aber eben nur die Wirecard-Bank. Dass die Bankenaufsicht sich aus der Verantwortung stiehlt mit der Einstufung, Wirecard sei ein Technologieunternehmen und deshalb habe man nicht das Unternehmen, sondern nur die dazugehörige Bank zu überwachen, zeigt das fehlende Verständnis für die Umwälzungen in der Branche. So auch der Umgang der BaFin mit den beiden Redakteuren der Financial Times, die den Skandal aufgedeckt haben. Sie geht gegen die Journalisten wegen Verdachts auf Insiderhandel vor, statt zunächst den Sachverhalt beim Unternehmen zu prüfen – das wäre aber doch der erste und dringlichste Schritt gewesen.
Der Wirecard-Skandal hat Anleger viel Geld gekostet und Vertrauen in den Aktienmarkt zerstört. Also: Raus aus den Aktien?
Nein, in der Sache bleibt richtig: Es gibt in Zeiten von Negativzinsen keine Alternative zu Aktien. Und es sind heute auch so viele Anleger in Aktien investiert wie nie zuvor. Ich bin nur etwas im Zweifel darüber, ob Anleger derzeit über ihren Einstiegszeitpunkt hinreichend diversifizieren. Wenn alle in den Markt hineinspringen, und dann möglicherweise wieder heraus, sobald raue Zeiten kommen, ist das Verlustrisiko groß. Mein Rat: Investieren Sie in Aktien, indem Sie den Aktienanteil in Ihrem Portfolio allmählich erhöhen, aber schichten Sie nicht alles sofort in Aktien um! Es besteht immer auch das Risiko, dass die Europäische Zentralbank bei steigender Inflation aus ihrer Niedrigzinspolitik aussteigt – und dann werden die Aktienkurse wieder fallen. Insgesamt aber bin ich ein großer Fan von Aktien, weil man damit an echten Unternehmen beteiligt ist und man wunderbar diversifizieren kann.
Viele Kleinanleger hatten große Hoffnungen in preisgünstige Robo-Advisor, digitale Vermögensverwalter, gelegt. Zu Recht?
Viele dieser Robo-Advisor verfolgen eine rationale Anlagestrategie, die besagt: Kaufe das Marktportfolio und skaliere es je nach Risikopräferenz rauf und runter, indem du mehr oder weniger in risikolose Anlageklassen anlegst. Den damit verbundenen Diversifikationseffekt kann man aber auch ohne Robo-Advisor gut umsetzen. Dafür gibt es zum Beispiel ETFs, insbesondere auch Indexfonds. Wir wissen aus der Finanzierungstheorie: Die Diversifikationseffekte werden marginal immer kleiner, je weiter man diversifiziert. Die Frage, ob man hinter der Kommastelle ein wenig mehr portugiesische oder italienische Staatsanleihen hat, ist also relativ gleichgültig. Investieren Sie in einen ETF auf den Dax, einen auf europäische Staatsanleihen, einen auf andere Assets, alles ist möglich. Das muss nicht einmal besonders systematisch sein. Schon mit naiver Diversifikation bekommt man einen großen Teil der diversifizierbaren Risiken aus dem Portfolio. Ich plädiere aber dafür, auch zu experimentieren.
Sie meinen, man sollte ruhig auch mal höhere Risiken eingehen?
Sicher, Geldanlage ist Teil des Lebens und sollte auch Spaß machen. Wie jedes andere Hobby darf das dann auch mal Geld kosten – natürlich nicht zu viel. Dieses Spielerische aber fehlt meiner Ansicht nach den derzeitigen Robo-Advisors. Sie sind im Spannungsfeld zwischen Kapitalmarkttheoretikern und Juristen entstanden. Wen die derzeitigen Anbieter brauchen, das ist der Psychologe, der Marketingprofi, der es schafft, dem Ganzen auch Lust und Spaß an der Geldanlage einzuhauchen.
China möchte zu den Olympischen Spielen 2022 eine digitale Währung einführen. Die Europäische Zentralbank will nachziehen. Was macht denn eine digitale Währung interessant?
Die dezentralisierte Technologie erschwert Manipulationen, und man wird die Währung wählen können, die die günstigsten Transaktionskosten hat. Nur halte ich persönlich es noch lange nicht für ausgemacht, wo im digitalen Bereich eine digitale Währung anzusiedeln ist, etwa ob dezentrale oder zentralisierte Technologien verwendet werden. Die dezentrale Blockchain-Technologie hat bestimmte Vorteile in der Eigentumssicherung. Aber sie hat den Nachteil, dass sie enorme Datenmengen produziert, viel Rechenkapazität bindet und viel Energie verbraucht. Außerdem sind Transaktionen auch nicht schneller als die zentralisiert ausgeführten Online-Transaktionen einer Geschäftsbank. Im Übrigen glaube ich, dass sich die Staaten schon aus politischen Gründen das Währungsmonopol nicht nehmen lassen werden. Das Thema digitale Währung könnte also noch Überraschungen bereithalten.
Werden die klassischen Geschäftsbanken überflüssig?
Nein. Wo immer man einen verlässlichen Finanzierungspartner braucht, wird man mit Unternehmen zu tun haben, die wie Banken agieren und im Zweifel auch eine Bank sind. Die Probleme wirtschaftlichen Handelns bleiben die gleichen, ganz gleich mit welcher Technologie die dazugehörigen wirtschaftlichen Transaktionen durchgeführt werden. Banken sind die Spezialisten für Kreditrisiken aus Finanzierungsbeziehungen, und solche Risiken müssen bewertet und gemanagt werden, egal ob die Finanzierung in Bitcoin, Ethereum, Euro oder in Schweizer Franken läuft. Die Bank wird als Vermittlerin zwischen Zentralbanken und Kreditnehmern und zwischen Währung und Verbrauchern weiterhin eine zentrale Rolle einnehmen – auch wenn die Ausgestaltung dieser Rolle sich derzeit wandelt.
Prof. Dr. Hans-Peter Burghof
ist Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der
Universität Hohenheim